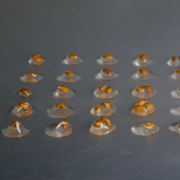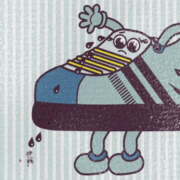Österreich-Premiere
Orlando versucht einen unauffälligen Besuch in der Sauna zu meistern kennt aber die Regeln nicht. Paula traut sich nicht, sich vor den anderen auszuziehen. Manu will einfach nur Kontakte knüpfen. Lauras schöner Cousin will nicht zugeben, dass er nicht schwimmen kann. Die schöne Lea schämt sich für nichts und Thea versucht, von Lauras schönem Cousin, den sie begehrt, nicht gesehen zu werden. Das jüngste Kapitel im filmischen Œuvre von Marie Luise Lehner ist ein glühendes Manifest für das Brechen von gesellschaftlichen Normen und Schamzuschreibungen und eine liebevolle Hommage an queere Körper, queere Identitäten und ein äußerst spielfreudiges Künstler*innen-Ensemble.